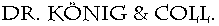
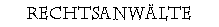
Die Lieferantin einer Software hat diese dem Kunden gegen eine einmalige Zahlung
sowie einer jährlichen "Erneuerungsgebühr" überlassen. Der Formularvertrag war
als Lizenzvertrag bezeichnet und sah u.a. vor, daß die zusätzliche Nutzung der
Software auf weiteren Rechnern sowie auf Rechnern größerer Kapazität den
Abschluß eines separaten "Systemverzeichnisses", also einer Neuberechnung der
Vergütung unter Anrechnung der bereits gezahlten Vergütung, erfordere.
Nach zwei Jahren ersetzte der Anwender die im Vertrag aufgeführte EDV-Anlage
durch eine neue, leistungsfähigere Hardware. Allerdings hatte die Aufteilung der
EDV-Anlage in "virtuelle Maschinen" zur Folge, daß für die Software genau
dieselbe Rechenleistung wie zuvor zur Verfügung stand; die größere Kapazität der
neuen EDV-Anlage wurde für andere Zwecke genutzt.
Aufgrund einer Programmsperre lief die Software jedoch nicht auf der neuen
Hardware. Nach Mitteilung eines neuen Paßworts war die Benutzung der Software
möglich, so daß der Anwender die Software auf der alten Hardware löschte.
Allerdings erlaubte das neue Paßworts nur die Benutzung der Software für sechs
Wochen. Die Lieferanten forderte die Zahlung einer höheren "Lizenzgebühr" und
berief sich auf die vertragliche Regelung hinsichtlich der Benutzung der Software
auf einer leistungsfähigeren Hardware.
Nach einiger Korrespondenz, weiteren temporären Freischaltungen der Software
und der Ankündigung der Lieferantin, daß ein weiteres Paßwort nur bei
Unterzeichnung einer Änderungsvereinbarung sowie der Erfüllung ihrer
Zahlungsforderung erteilt werde, gab der Anwender nach. Er unterzeichnete die ihm
angedienten Änderungsvereinbarung und zahlte die zusätzliche Vergütung unter
dem ausdrücklichen Vorbehalt, hierzu gezwungen zu sein, und unter
Aufrechterhaltung seines Rechtsstandpunktes.
Der Anwender verlangte nach Erteilung des Paßworts die Zahlungen zurück und
verklagte die Lieferantin, als diese sich weigerte zu zahlen. Das Landgericht
Frankfurt a.M. gab dem Anwender recht; das Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
bestätige die insofern Entscheidung des Landgerichts und wies die Berufung der
Lieferantin mit Urteil vom 14.12.1999[1] zurück.
Das OLG Frankfurt hat zunächst festgestellt, daß der Anwender den
Zahlungsanspruch der Lieferantin nicht anerkannt habe. Denn die Lieferantin habe
ihn mit einer Drohung zu der Zahlung veranlaßt. Die Drohung liege darin, daß die
Lieferantin das Beseitigen der Programmsperre von dem Anerkennen ihrer
Forderungen abhängig gemacht habe. Allein fraglich sei nach Meinung des
Oberlandesgerichts, ob die Lieferantin die Widerrechtlichkeit ihrer Forderung
bewußt gewesen sei. Denn zwar habe sie keinen Anspruch auf Erfüllung ihrer
Forderung besessen; erforderlich sei aber auch, daß sie in Kenntnis dessen gedroht
habe. Das OLG hat diese Frage jedoch offen gelassen. Denn da der Anwender nur
unter Vorbehalt unterzeichnet und gezahlt habe, habe er klar zum Ausdruck
gebracht, daß er seine entsprechende Erklärung nicht gegen sich gelten lassen
wollte. Eine wirksame Willenserklärung liege daher nicht vor, so daß die Lieferantin
ungerechtfertigt bereichert sei und das hierdurch Erlangte herausgeben müsse.
Entgegen der Meinung des Lieferantin habe sie ihre Forderung auch nicht auf den
Lizenzvertrag stützen können. Das Oberlandesgericht Frankfurt sah die
entsprechende Klausel, die bei Verbesserungen der Hardware eine höhere
Vergütung vorsah, als unzulässig an. Sie verstoße gegen § 9 AGB-Gesetz, da sie den
Anwender unangemessen benachteilige. Nach Sinn und Zweck der Regelung habe
die Lieferantin ihr urheberrechtliches Partizipationsinteresse für alle denkbaren
Fälle, in denen eine leistungsstärkere Hardware zur erhöhten Nutzbarkeit der
Software führe, sicherstellen wollen. Nach Meinung des Oberlandesgerichts sei die
Lieferantin hierzu auch grundsätzlich berechtigt gewesen. Denn im Gegensatz zu
einer früheren Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt, in der eine CPU-
Klausel nur gebilligt worden war, weil die Software nur auf einer bestimmten
Hardware eingesetzt werden konnte[2], liege hier kein Kaufvertrag vor. Die
Lieferantin habe die Software dem Anwender gerade nicht gegen Einmalzahlung
dauerhaft überlassen. Das OLG sah hier aufgrund der Einzelheiten der
Vertragsgestaltung eine nur vorübergehende Einräumung von Nutzungsrechten
durch den Urheber auf Basis eines urheberrechtlichen Nutzungsvertrags. Daher
seien die Überlegungen zur Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von CPU-Klauseln in
Kaufverträgen nicht einschlägig.
Nach Meinung des OLG Frankfurt hätten CPU-Klauseln in urheberrechtlichen
Nutzungsverträgen den Sinn, dem Hersteller eine angemessene zusätzliche
Vergütung für den Fall zu sichern, daß der Kunde die Software auf einer anderen,
leistungsfähigeren Maschine einsetzen wolle und damit einen höheren als den
erwarteten Nutzen daraus ziehe. Dieser Zweck entspreche dem Grundsatz, daß der
Urheber tunlichst an jeder wirtschaftlichen Nutzung seines Werks angemessen zu
beteiligen sei.
Zwar führe eine Aufrüstung der Hardware zu nicht unerheblichen
Nutzungsvorteilen bei der Software, die das Partizipationsinteresse des Urhebers
berühre. Das Oberlandesgericht sah jedoch keinen Anlaß, diese Frage abschließend
zu beurteilen, denn in dem vorliegenden Fall könne nicht von einer solchen
umfänglicheren Nutzung ausgegangen werden. Aufgrund der logischen Aufteilung
der neuen Hardware in "virtuelle Maschinen" und der Begrenzung der
Leistungsfähigkeit der virtuellen Maschine, mit der die Software verwendet werde,
auf die der alten Hardware, sei das Partizipationsinteresse der Lieferantin nicht
beeinträchtigt. Entgegen deren Meinung genüge auch nicht die bloße Möglichkeit,
die logische Aufteilung der Hardware zu verändern.. Solange dies nicht geschehen
sei, würde in die wirtschaftliche und betriebliche Bewegungsfreiheit des Anwenders
unter Verstoß gegen § 9 AGB-Gesetz unangemessen eingegriffen, wenn allein die
Benutzung einer anderen Hardware zusätzliche Zahlungspflichten auslösen würde.
Da die Lieferantin in der Lage war, die logische Aufteilung und damit den Umfang
der Nutzung der Software zumindest im Nachhinein zu kontrollieren, habe sie
letztlich die Möglichkeit, an einer gesteigerten Nutzung der Software zu
partizipieren, wenn diese erfolgen sollte.
Allerdings gab das OLG Frankfurt der Lieferantin recht und deren Berufung statt,
soweit sie diese gegen die Verurteilung wandte, die Programmsperre insgesamt zu
beseitigen. Nach Meinung des Oberlandesgerichts sei eine Programmsperre bei nur
zeitliche begrenzter Softwareüberlassung nicht zu beanstanden, wenn diese der
Verhinderung rechtswidriger Nutzungen nach Ablauf der vertraglichen
Überlassungsdauer diene.
Kommentar:
Der Entscheidung des OLG Frankfurt ist zwar im Ergebnis zuzustimmen. Die
Begründung überzeugt bei näherer Betrachtung jedoch nicht, steht sogar im
Widerspruch zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs und würde bei anderer
Fallgestaltung zu unzutreffenden Ergebnissen führen.
Es geht hier um zwei Rechtsfragen:
Zum einen war zu entscheiden, ob dem Urheber ein urheberrechtlich begründeter
bzw. begründbarer Anspruch zusteht, bei Einsatz einer leistungsfähigeren Hardware
ein zusätzliches bzw. höheres Entgelt zu verlangen. Die Betonung liegt auf
"urheberrechtlich begründbar", denn im Rahmen einer individuellen, vertraglichen
Regelung, also einer rein schuldrechtlichen Grundlage, wäre dies natürlich ohne
weiteres zu vereinbaren. Typischerweise werden solche Verträge aber als
Formularverträge geschlossen, so daß sich immer die Frage der unangemessenen
Benachteiligung den Anwenders nach § 9 AGB-Gesetz stellt. Gibt das Urheberrecht
aber keine gesetzliche Grundlage für diese Forderung, so ist die Unangemessenheit
ziemlich deutlich.
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat sich nun recht deutlich dafür ausgesprochen,
daß eine solche Forderung urheberrechtlich zu begründen sei. Zur Begründung
beruft es sich auf das Partizipationsinteresse des Urhebers. Allerdings berücksichtigt
das Oberlandesgericht nicht, daß sich dieses Partizipationsinteresse nur auf
urheberrechtliche Verwertungen bezieht. Grund mag die unpräzise und großzügige
Verwendung des Begriff der "Nutzung" auch für bloße Benutzung von Software
sein, die die Grenzen zwischen einer Nutzung im urheberrechtlichen Sinne, also
einer urheberrechtlichen Verwertung, und einer rein tatsächlichen Benutzung
verschwimmen läßt. Denn tatsächlich wird das urheberrechtliche
Partizipationsinteresse des Urhebers in keiner Weise durch die tatsächliche
Benutzung seines Werks tangiert, sofern diese nicht eine - zusätzliche -
urheberrechtliche Verwertung darstellt. Einige Beispiele mögen dies
veranschaulichen:
So ist es in urheberrechtlicher Hinsicht völlig gleichgültig, ob man z.B. eine CD
alleine hört oder in einer Gruppe von Freunden. Mit der Auffassung des
Oberlandesgerichts Frankfurt - die natürlich nicht vom Himmel gefallen ist sondern
sehr an entsprechende Publikationen von Interessenvertretern großer
Softwarehersteller erinnert - aber müßte man dem Urheber eine höhere/zusätzliche
Vergütung zubilligen, wenn mehr als eine Person von den Lautsprechern beschallt
wird, mehr als ein Kopfhörer angeschlossen ist oder die Stereoanlage in der Lage ist,
einen Raum zu beschallen, der größer ist als z.B. eine kleine Toilette; allgemein
müßte sich also die Tantieme des Musikers (bzw. die Abgabe an die GEMA) nach
der Leistungsfähigkeit des im konkreten Fall genutzten Verstärkers sowie der Größe
des Hörraums bemessen.
Gleiches gilt für Videokassetten: Deren Lizenzvergütung für den Urheber müßte
nach dem Bildschirmdurchmesser des an den Videorekorder angeschlossenen
Fernsehgeräts bemessen werden. Denn je größer der Bildschirm, desto weiter
entfernt kann man sitzen und desto mehr Leute können den Film anschauen.
Auch Bücher mit besonders großer Schrift müßten dem Autor eine höhere Tantieme
bringen als klein gedruckte Bücher, da groß gedruckte Bücher von mehreren
gleichzeitig gelesen werden können. Gleiches gilt natürlich, wenn man Bücher
seiner Familie bzw. seinen Kindern vorliest.
Und bei Bildern oder sonstigen Gegenständen der bildenden Kunst muß die Zahl der
- möglichen - Betrachter den Maßstab bilden. Je größer der Raum also, indem sich
das Kunstwerk befindet, desto größer die pekuniäre Beteiligung des Künstlers.
Natürlich ist dies alles absurd. Aber all diesen Beispielen ist gemeinsam, daß das
urheberrechtlich geschützte Werk mal mehr, mal weniger intensiv genossen bzw.
benutzt wird. Dennoch kommt hier niemand ernsthaft auf die Idee, zusätzliche oder
höhere Vergütungen zu fordern - denn es ist evident, daß hiermit keine
weitere/intensivere urheberrechtliche Verwertung verbunden ist.
Man könnte nun auf die Idee kommen, und die vom Oberlandesgericht Frankfurt
verwendete "altehrwürdige" - schon vom Reichsgericht verwendete - Formel, den
Urheber tunlichst überall an dem wirtschaftlichen Nutzen zu beteiligen, der aus
seinem Werk gezogen wird[3] so verstehen, wie es offenbar das Oberlandesgericht
getan hat: Daß danach jeder Gewinn erfaßt sei, der durch Benutzung des Werks
erzielt werde. Dies wäre indes bei weitem nicht mehr durch das Urheberrecht
gedeckt. Denn die Verwertungsrechte des Urhebers beziehen sich nur auf die
Nutzung des Werkes durch dessen aktiven, urheberrechtliche relevanten Gebrauch,
sei es durch Herstellung von Vervielfältigungsstücken, sei es zur Vermittlung dessen
geistigen Inhalts durch Inverkehrbringen oder durch unkörperliche Wiedergabe. Der
rezeptive Genuß des Werkes durch Lesen, Hören oder Anschauen, also das rein
tatsächliche - und bestimmungsgemäße - Benutzung, die "Begegnung zwischen
Werk und Publikum", ist dem Recht des Urhebers nicht unterworfen[4]. Die dem
Urheber vorbehaltene und daher entgeltspflichtige urheberrechtliche Nutzung bzw.
Verwertung sind also nur die Handlungen, welche die "Begegnung zwischen Werk
und Publikum" im Sinne einer Werkverwertung ermöglichen. Denn andernfalls
müßte man auch z.B. den wirtschaftlichen Nutzen, den Unternehmer aus
Fachbüchern ziehen, lizenzpflichtig machen. So müßte man, wollte man dem OLG
Frankfurt folgen, auch dem Programmierer, der anhand der Fachliteratur JAVA
lernt und daraufhin mit diesem Wissen seine Brötchen verdient, verurteilen, an die
Autoren der Bücher zusätzliche Lizenzgebühren entsprechend seiner eigenen
Gewinne zu zahlen. Eine ebenfalls absurde Vorstellung, die jedoch deutlich macht,
wie unvereinbar die Beteiligung des Urhebers an den wirtschaftlichen Nutzen, der
allein durch die Benutzung, den Gebrauch seines Werks beim Benutzer entsteht, mit
unserem Urheberrecht ist.
Der Einsatz, also die Benutzung, einer Software für sich stellt aber auch keine
urheberrechtliche Verwertung dar. Zwar erfolgen im Laufe der Benutzung
verschiedene Kopiervorgänge, die man teilweise sogar als urheberrechtliche
Verwertung ansehen muß - etwa die Installation der Software. Ob man bei den
vielfältigen technischen Kopiervorgängen, die bei der Benutzung als solcher
erfolgen, von urheberrechtlichen Vervielfältigungen sprechen kann, muß man aber
schon grundsätzlich bezweifeln - schon deswegen, weil in aller Regel von außen
betrachtet nur ein Vervielfältigungsstück vorliegt und es z.B. für den Urheber
offenkundig auch völlig unerheblich ist, ob die Software auf bzw. in einer Festplatte
nur in einem Verzeichnis oder in deren zehn vorhanden ist. Denn letztlich handelt es
sich nur um technisch bedingte Kopiervorgänge, die bei einer anderen
Computertechnik nicht anfallen würden. Die Vorstellung ist absurd, daß die
Benutzung von z.B. einer Textverarbeitungssoftware in einem normalen PC
aufgrund des Ladens der Software in den Hauptspeicher eine urheberrechtliche
Verwertungshandlung darstellen sollte, was für die Benutzung einer fest in ROM
einem der vielfältigen Organizer "verdrahteten" und dort ablaufenden
Textverarbeitung mangels eines solchen Kopiervorgangs jedoch ersichtlich nicht
zutrifft. Die reine Benutzung der Software ist aber urheberrechtlich ebenso neutral
wie das Anschauen eines Films, eines Bildes, das Lesen eines Buchs oder das
Anhören eines Musikstücks[ausführlich 5].
Etwas überraschend ist aber, daß der Bundesgerichtshof diese Frage an sich längst -
und zwar im hier vertretenen Sinne - entschieden hat: In der durchaus bekannten
und in der rechtswissenschaftlichen Literatur heftig kommentierten
"Betriebssystem"-Entscheidung aus dem Jahr 1990[6] hat er ausdrücklich
festgestellt, daß allein die Ausgabe des Programms auf den Bildschirm als
maßgebliche Vervielfältigungshandlung ausscheide, da hierbei keine körperliche
Festlegung und Wiedergabe erfolge. Ferner falle die reine Benutzung des
Programms aus dem Bereich des Urheberrechts heraus, da auch die Benutzung eines
anderen Werkes - z.B. das Lesen eines Buches - keinen urheberrechtlich relevanten
Vorgang darstelle[7]. Diese Feststellungen des BGH beanspruchen nach wie
Gültigkeit und sich auch nicht etwa durch die europäische Gesetzgebung überholt.
Zumindest als Jurist fragt man sich da verwundert, wieso u.a. das OLG Frankfurt
diese Entscheidung nicht beachtet hat.
Weiter ist zu bemängeln, daß das Oberlandesgericht die ablehnende Entscheidung
aus dem Jahr 1994 mit der Begründung als irrelevant bewertet, daß es sich damals
um eine kaufrechtliche Fallgestaltung gehandelt habe. Denn der Verweis darauf, daß
demgegenüber hier ein urheberrechtlicher Nutzungsvertrag vorliege, negiert die
gefestigte Rechtsprechung auch des Bundesgerichtshofs. Es ist nämlich schon seit
Jahren anerkannt, daß die dauerhafte Überlassung einer Standardsoftware einen
urheberrechtlich irrelevanten Kauf - sogar einen Sachkauf - nach § 433 BGB
darstellt und die nur vorübergehende Überlassung folglich auf Grundlage eines
(einfachen) Mietvertrags erfolgt. Offensichtlich hat sich das Oberlandesgericht
durch die - natürlich seitens des Lieferanten mit Bedacht erfolgte - unzutreffende
Bezeichnung des Vertrags und die darin aufgestellte Behauptung, es würden
Nutzungsrechte übertragen werden, beeinflussen lassen. Es ist aber für die Frage, ob
eine urheberrechtliche Verwertung erfolgt und ob urheberrechtliche
Verwertungsrechte übertragen werden, offensichtlich ohne jede Bedeutung, ob die
Software dauerhaft oder nur auf Zeit überlassen wird. Die Art der Benutzung der
Software ist in beiden Fällen offensichtlich identisch; die hierfür ggfs.
erforderlichen Rechte ebenfalls. Würde die Benutzung einer Software eine
urheberrechtliche Verwertung darstellen, so würde dies bei sowohl für deren
dauerhafte als auch deren zeitlich begrenzte Überlassung gelten. Ist sie dagegen
urheberrechtlich irrelevant, so gilt dies für die dauerhafte wie auch zeitlich begrenzte
Überlassung.
Folgt man hier der gefestigten - und i.ü. gerichtlicherseits allseits akzeptierten -
Bewertung des Bundesgerichtshofs, nach der sich die Überlassung einer
Standardsoftware auf Grundlage eines normalem Kaufvertrags vollzieht [zuletzt 8],
so ist unbestreitbar, daß im vorliegenden Fall ungeachtet der Bezeichnung des
Vertrags als "Lizenzvertrag" und der behaupteten Übertragung von
"Nutzungsrechten" nur ein Mietvertrag vorlag und keine urheberrechtlichen
Verwertungsrechte übertragen wurden. Die Folge ist, daß der Lieferantin gerade
keine urheberrechtliche Berechtigung zustand, für eine "intensivere" Benutzung auf
einer leistungsstärkeren Hardware zusätzlich bzw. mehr Geld zu verlangen.
Die andere Frage war, ob Programmsperren grundsätzlich zulässig sind. So sehr mir auch Programmsperren gefühlsmäßig zuwiderlaufen, läßt sich gegen die Begründung des Oberlandesgerichts doch kaum ein Argument anführen. Dient die Programmsperre wirklich nur der Verhinderung der rechtswidrigen Benutzung nach Ende der Überlassungszeit - also nach dem Ende des Mietvertrags -, so stellt dies keine unangemessene Benachteiligung des Anwenders dar. Selbstverständlich muß er nach dem Ende des Vertrags die Software zurückgeben und vorhandene Kopien löschen bzw. deren Benutzung einstellen. Allerdings wird man diese Frage nur anhand der konkreten Vertragsbestimmungen und meines Erachtens auch dem Verhalten des Lieferanten während der Vertragslaufzeit beurteilen können. Verhält sich ein Lieferant so wie hier, d.h. benutzt er die Programmsperre auch zu Durchsetzung anderer Ziele, muß man diese alleinige Zweckbestimmung der Programmsperre bezweifeln und dieser daher als unzulässig bewerten.
Allerdings verbleibt auch bei einer nicht zu beanstandenden Programmsperre das Risiko, daß der Anwender bei z.B. einer unwirksamen Kündigung des Lieferanten das Nachsehen hat. Bei Miete einer anderen Sache bzw. ohne eine solche Programmsperre müßte der Lieferant den Anwender auf Herausgabe verklagen. In diesem Prozeß würde die Wirksamkeit z.B. der Kündigung überprüft werden. Bis dahin könnte der Anwender die Mietsache - also auch die Software - weiter benutzen. Dies würde den Lieferanten auch nicht benachteiligen. Denn wenn sich die Kündigung als berechtigt erweist, muß der Anwender für die nach der Kündigung erfolgte Benutzung eine entsprechende Vergütung zahlen. Zwar kann bei einer Programmsperre der Anwender versuchen, im Wege einer einstweiligen Verfügung den Lieferanten zu zwingen, im bis auf weiteres die Programmsperre freizuschalten. Abgesehen von der Zeitdauer dieses Verfahrens, die im Einzelfall zu erheblichen Problemen beim Anwender führen kann, erfolgt im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nur eine kursorische Prüfung. D.h. die Wahrscheinlichkeit, daß komplizierte Rechtsfragen unzutreffend beurteilt werden, ist signifikant höher. Zwar würde der Lieferant letztlich Schadensersatz leisten müssen, wenn sich im Hauptverfahren die Unrichtigkeit seiner Rechtsauffassung herausstellt. Dies würde dem Anwender aber nichts nutzen, wenn er zwischenzeitlich wegen der Nichtbenutzbarkeit der Software insolvent geworden ist.
[1] Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. vom 14.12.1999, Aktenzeichen 11
U 7/99, abgedruckt in Computer und Recht 3/2000, S.146
[2] Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. vom 10.3.1994, Aktenzeichen
6 U 18/93, abgedruckt in Computer und Recht 7/1994, S.398
[3] Bundesgerichtshof, Urteil vom 3.7.1981, Aktenzeichen I ZR 106/79, abgedruckt
in Computer und Recht 1982 S.102f mit weiteren Nachweisen
[4] Bundestags-Drucksache IV/270 S.28
[5] Dr. M. Michael König, "Das Computerprogramm im Recht", 1991, Rdnr.479ff
[6] Bundesgerichtshof, Urteil "Betriebssystem" vom 4.10.1990, Aktenzeichen I ZR
139/89, nachzulesen in jur-PC 1/1991, S.888
[7] Dr. M.Michael König, "Programm für ROM und RAM", c t 3/92, S.68ff
[8] Urteil des Bundesgerichtshofs vom 22.12.1999, Aktenzeichen VIII ZR 299/98,
abgedruckt in Computer und Recht 4/2000, S.207
Der Softwarelieferant kann zumindest dann keine zusätzliche bzw. höhere
Vergütung wegen Verwendung einer leistungsfähigeren Hardware verlangen, wenn
deren größere Leistungsfähigkeit bei dem Einsatz der Software tatsächlich nicht
ausgenutzt wird.
Programmsperren sind in Mietverträgen über Software zulässig, wenn sie nur dazu
dienen, eine rechtswidrigen Benutzung nach Ende des Mietvertrags zu verhindern.
Dieser Beitrag ist in bearbeiteter Form in c´t 16/2001 S.170 erschienen. Er gibt die Rechtslage und Meinung des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder.
