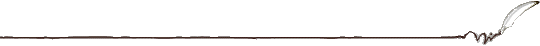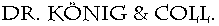
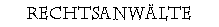
Die elektronische Datenverarbeitung ist zu einem wichtigen Teil unseres Wirtschaftslebens
geworden. Ungeachtet der wirtschaftlichen Auswirkungen des Einsatzes und der Verwendung
moderner Computertechnik zeugen allein schon die im unmittelbaren Zusammenhang mit der
EDV erzielten Umsätze von deren wirtschaftlicher Bedeutung. So lag in Deutschland der
Marktumfang 1988 bei 36,8 Milliarden DM; auf Software und Service entfielen hiervon 39%,
auf Hardware 50%[1]. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr - 1987 - wird auf 15% bis 22%
geschätzt; der Hardwareumsatz dagegen stagniert. Besonders interessant ist, daß das Geschäft mit
Standardsoftware um etwa 26% wuchs, während der Zuwachs bei der Auftragsprogrammierung
lediglich mit 15% zu registrieren war; mittlerweile sollen 70% des Umsatzes auf
Standardsoftware entfallen[2]. Für 1993 wird ein Marktumfang von insgesamt 63 Milliarden DM
erwartet, wovon allein auf Software und Service 53% und auf Hardware nur 37% entfallen
sollen[3]. Noch 1983 betrug der Softwareumsatz in Deutschland lediglich etwa 5 Milliarden DM;
der Hardwarebereich kam auf etwa 8,2 Milliarden DM[4]. Hieraus können unschwer zwei
Tendenzen abgelesen werden: Zum einen ist von einer weiteren deutlichen Steigerung der
wirtschaftlichen Bedeutung der EDV auszugehen, zum anderen verschiebt sich innerhalb des
Bereichs der EDV der Schwerpunkt vom Hardwarebereich in erheblichem Umfang zum
Softwarebereich.
Ohne bereits an dieser Stelle auf die schwierige Frage der Abgrenzung beider EDV-Bereiche
eingehen zu wollen, soll Hardware plakativ als greifbares Technikprodukt, Software dagegen als
die eingesetzten Programme, die das technische Gerät erst "zum Laufen bringen", bezeichnet
werden[5]. Während die rechtliche Einordnung der Hardware-Verträge keine besonderen
Probleme bereitet, herrscht hinsichtlich der Beurteilung von Verträgen, welche Überlassung von
Software zum Gegenstand haben - im Folgenden als Software-Überlassungsvertrag bezeichnet -,
eine nahezu chaotische Meinungsvielfalt. Es werden nahezu alle bekannten Vertragstypen für
einschlägig erachtet - der Software-Überlassungsvertrag soll Sachkaufvertrag[6],
Rechtskaufvertrag[7], Mietvertrag[8], Rechtspachtvertrag[9], Werkvertrag[10] bzw.
Werklieferungsvertrag[11], Dienstvertrag[12], Vertrag über Einräumung eines Nießbrauchs[13],Lizenzvertrag[14], Know-how-Vertrag[15]
und schließlich ein Vertrag sui generis[16], auf den jenach Belieben die verschiedensten Regeln analog
angewendet werden, sein. Währendverschiedene Überlassungsmodalitäten - z.B. die Dauer der Überlassung -
durchausunterschiedliche Beurteilungen der Rechtsfolgen rechtfertigen können, erscheint die Möglichkeit
der Bewertung desselben Vertrages als z.B. Sachkaufvertrag und Lizenzvertrag unerträglich. Dabei ist die Bezeichnung des Vertrages
und damit die rein begriffliche Zuordnung zu einem bestimmten Vertragstyp solange von untergeordneter Bedeutung, wie sich dieses nicht auf die Rechtsfolgen auswirkt. Von entscheidender Wichtigkeit sind jedoch die sich aus der Zuordnung ergebenden Rechtsfolgen in bezug
auf die Vertragsabwicklung.
Im Vordergrund steht die Frage nach dem anzuwendenden Gewährleistungsrecht, denn in
dem Maße, in dem der Vertrieb von Software erhebliche wirtschaftliche Bedeutung erlangt,
entsteht ein Bedürfnis nach Rechtssicherheit gerade hinsichtlich der Behandlung von Mängeln[17]
sowie der Verjährung der aus dem Vertrag resultierenden Ansprüche[18]. Dieses Interesse besteht
sowohl auf der Seite der Hersteller bzw. Lieferanten als auch der Anwender[19]. Auch und gerade
weil Software nach Behauptungen der Hersteller und Lieferanten nie fehlerfrei sein könne, [20]
kann der Auffassung Kilians, die Einordnung von Software-Überlassungsverträgen in gesetzlich
normierte Vertragstypen sei von untergeordneter Bedeutung[21], nicht gefolgt werden: Da allein
die gesetzlich geregelten Vertragstypen im Grundsatz verbindliche Gewährleistungsregeln
vorsehen, können beide an einer Software-Überlassung beteiligten Parteien nur bei Zuordnung
des Software-Überlassungsvertrages zu einem dieser Vertragstypen die Risiken und Gefahren
annähernd abschätzen und in ihre wirtschaftlichen Entscheidungen einbeziehen. Dies bedeutet
nicht, daß der Software-Überlassungsvertrag um jeden Preis in das Korsett eines der gesetzlich
geregelten Vertragstypen gezwängt werden muß - es ist jedoch im Interesse aller Beteiligten
geboten, den Vertragsgegenstand Computerprogramm unter Berücksichtigung dessen
Eigenarten, Herkunft, Zweck und wesensmäßigem Umfeld daraufhin zu untersuchen, ob der
Zugriff auf nicht geregelte und deshalb die Rechtssicherheit nicht fördernde Vertragsarten
erforderlich und angemessen ist, oder ob nicht vielmehr die vorhandenen gesetzlichen Regelungen einfacher und befriedigender die Möglichkeit bieten, auch dieses scheinbar neue
Wirtschaftsgut sachgerecht zu erfassen.
Diese Untersuchung ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Eine Beschränkung erfolgt
insofern, als lediglich Vertragsbeziehungen zwischen Hersteller bzw. Händler - allgemein
Lieferant - und (End)Anwender berücksichtigt werden, denn die zwischen Hersteller und
Händler geschlossenen Vertriebsverträge beinhalten regelmäßig eine Vielzahl zusätzlicher,
vertriebsspezifischer Regelungen, welche für die hier zu behandelnden Fragen irrelevant sind
und ohnehin einer vollständigen Zuordnung zu einem der gesetzlich geregelten Vertragstypen
entgegenstehen.
Zur sachgerechten Beurteilung von Computerprogrammen müssen diese in ihrem Wesen und
ihrer Stellung im System der EDV erfaßt und verstanden werden. Ein wichtiger Teil der
Untersuchung liegt also in deren Analyse sowohl aus technischer als auch programmtechnischer
Sicht.
Die Erfahrung zeigt, daß komplizierte und abstrakte Zusammenhänge oft anhand von kurzen
Beispielen besser verstanden werden, als dies durch notwendigerweise umständliche
Erläuterungen erreicht werden kann. Da mittlerweile infolge der enormen Verbreitung von
Personalcomputern[22] (PC) für einen respektablen Teil der Leserschaft der Umgang mit diesen
zur täglichen Arbeit zählt, sind die Voraussetzungen gegeben, um die technikbezogenen Aspekte
der Computerprogramme an für den Leser nachvollziehbaren Beispielen illustrieren zu
können[23]. Sofern daher im folgenden praktische Beispiele ein besseres Verständnis erwarten
lassen, so werden diese dem Bereich der Personalcomputer auf Grundlage des mit Abstand am
weitesten verbreiteten Betriebssystems MS-[24]DOS, PC-DOS oder DR-DOS, nachfolgend nur
mit "MS-DOS" bezeichnet, entnommen.
Andererseits kann nicht unberücksichtigt bleiben, daß Computerprogramme im Rahmen eines
geistigen Schöpfungsprozesses entstehen, welcher Kreativität und Ideen erfordert. Dies kann zur
Folge haben, daß Programme immaterielle Wirtschaftsgüter darstellen und u.U. sondergesetzlich
geschützt sind. Die Untersuchung muß also ebenfalls die sich hieraus möglicherweise
ergebenden Auswirkungen auf schuld- und sachenrechtliche Belange einbeziehen.
Im Rahmen der schuldrechtlichen Bewertung der Software-Überlassungsverträge ist von
Bedeutung, inwieweit die gesetzliche Regelung einzelner Schuldverhältnisse eine bestimmte
Zuordnung vorgibt. Es stellt sich also die Frage, ob und in welchem Umfang trotz
Einschlägigkeit eines bestimmten gesetzlich geregelten Vertragstyps die Nichtanwendung der
entsprechenden Normen - z.B. infolge von Parteiabreden - möglich ist, oder ob trotz
Vertragsfreiheit im Schuldrecht die gesetzlich geregelten Vertragstypen zwingend sind, wenn
diese den mit dem Vertrag abgestrebten wirtschaftlichen Zweck oder Erfolg zum Gegenstand
haben.
Schließlich ist zu untersuchen, ob grundsätzlich einschlägige Gewährleistungsvorschriften wegen
spezifischer Besonderheiten der Computerprogramme - als Beispiel sei die oben angesprochene
angeblich zwangsläufige Fehlerhaftigkeit von Software-Produkten angeführt - einer bestimmten
Auslegung oder Anpassung bedürfen, um sach- und interessengerechte Ergebnisse zu
ermöglichen.
----------
1) FAZ 56/89, B6
2) FAZ 150/89, 14; FAZ 205/89, 16; auch im Bereich der Großrechner überwiegt die
Bedeutung der Standardprogramme, deren Qualität schon seit einiger Zeit die der
Individualprogramme übersteigt, vgl. Plattner Compas '85, 213f
3) FAZ 56/89, B6
4) Dworatschek 35
5) ähnlich Breidenbach CR 89, 873; Greve 17, 26; Hirschberg CR 88, 742; Junker BB 88, 1334;
Kienzle 20; Köhler M. CR 88, 75; Koren/Thaller 67; Korn Steuerdialog 85, 6190; Lehmann BB
88, 1334; Maier NJW 86, 1909; Owles PHI 83, 126; Sontheimer DStR 83, 350; Wittmer 31;
zur Abgrenzung eingehend unten bei B.I. Rdnr.75ff und B.IV. Rdnr.216ff
6) z.B. BGH VIII ZR 325/88 v.18.10.89 DB 89, 2596; BGH VIII ZR 314/86 v.4.11.87 NJW
88, 406; Brandi-Dohrn RuVvC 622, Rdnr.3; Geissler RuVvC 393, Rdnr.4; Hoeren CR 88, 908;
König DB 89, 2597
7) Bömer 138; Sontheimer DStR 83, 350
8) z.B. OLG München 7 U 2373/87 v.30.9.87 CR 88, 130; Bartl BB 88, 2122, 2123f; Transki
Compas '85, 1189, 1195
9) z.B. BGH VIII ZR 153/80 v.3.6.81 NJW 81, 2684; Heussen GRUR 87, 779, 788ff; Lehmann
CR 87, 422, 423; Lutz GRUR 76, 331, 432f
10) z.B. Junker Rdnr.315; Lesshafft/Ulmer CR 88, 813, 815ff; Mehrings NJW 88, 2438,
2439f
11) z.B.OLG Hamm 10 U 63/84 v.28.5.86 IuR 86, 396; Soergel-Huber Rdnr.81a vor 433
12) z.B. BGH I ZB 8/84 v.2.5.85 GRUR 85, 1055; Gaul CR 88, 441; Paulus CR 87, 651, 658
13) Kilian CS+SH 19, 21; Tybusseck Rdnr.22
14) z.B. BGH VIII ZR 43/86 v.25.3.87 NJW 87, 2004; Lehmann NJW 88, 2419, 2421; Ruppelt
CR 88, 994, 995; Staber CR 88, 715, 716
15) z.B. BGH VIII ZR 153/80 v.3.6.81 NJW 81, 2684; Zahrnt Rechtsfragen 212; Bömer 138;
Kilian 42; ders. SvCS 11, 19; Moritz CR 89, 1049, 1053f
.16) z.B. Abel RDV 87, 212; Brandi-Dohrn CR 86, 63, 68f; Erdmann CR 86, 249, 257f
17) Abel RDV 87, 212; Ehricke CR 89, 665.666
18) Staber CR 88, 715
19) Staber indes sieht dies zu einseitig aus der Sicht eines Interessenvertreters des Herstellers:
Staber aaO
20) vgl. z.B. Bömer CR 89, 361; Junker 412; Müller-Hengstenberg CR 86, 441; Tiling CR 87,
80; v.Westphalen CR 87, 477; Wittmer 59; hierzu eingehend unten bei C.III.2.d)bb)(1)
Rdnr.674ff
21) Kilian 48
22) Von den am 1.1.1989 in Deutschland installierten 2,45 Millionen Computersystemen zählten
nach Diebold 2, 1 Millionen zu der Gruppe der Mikrocomputer, die nach Diebold ausschließlich
aus Personalcomputern besteht. In Wahrheit liegt diese Zahl und damit der Anteil der
Personalcomputer weitaus höher, denn Diebold berücksichtigte lediglich Angaben einiger
bekannter Hersteller, die außerdem nicht vollständig waren. Nicht berücksichtigt wurden neben
bekannten Herstellern wie Compaq, Epson, TA Triumph Adler und andern die ungeheuer große
Zahl der "Namenlosen", also der No-Name-Kompatiblen aus Taiwan oder Korea: vgl. PC-
Magazin 23/89, 6. Der Anteil der Personalcomputer dürfte also mit 95% bis 99% durchaus
realistisch geschätzt sein.
23) Anders noch z.B. Wittmer, der sich sowohl aufgrund seiner beruflichen Entwicklung als auch
der damaligen Marktverhältnisse auf Großanlagen - Mainframes - beschränkte.
24) Für die notwendige Erläuterung spezifischer Fachtermini vgl. unten bei B. ab Rdnr. 83ff
Das Buch ist mittlerweile bis auf wenige Restexemplare vergriffen und nicht mehr über den Buchhandel erhältlich. Diese Restexemplare können beim Autor bestellt werden.